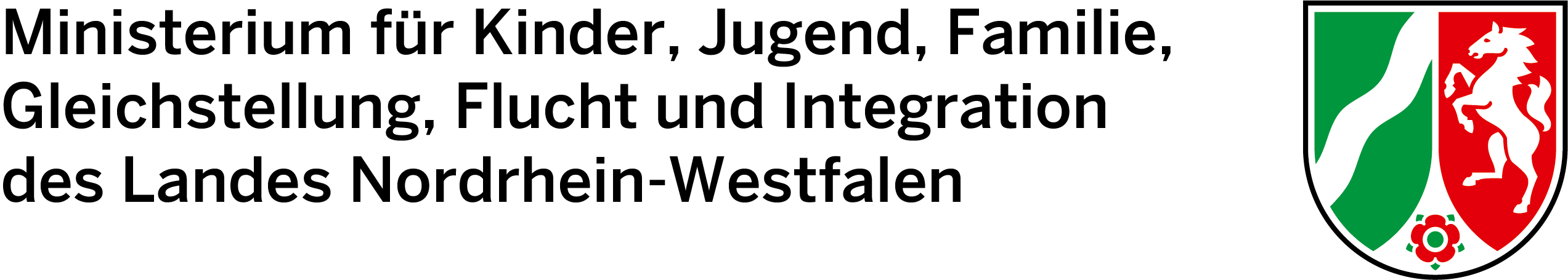Glossar
Pädagogische Begriffe von A bis Z kurz erklärt
Glossar zu wichtigen pädagogischen Begriffen
In den Bildungs- bzw. Orientierungsplänen für die Kindertagesbetreuung in allen Bundesländern wird Kita-Trägern empfohlen, in ihren Einrichtungen eine Praxis der Beobachtung und Dokumentation kindlicher Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu etablieren. Beobachtung und Dokumentation sind seit Einführung der Bildungs- und Orientierungspläne zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal der Bildungsarbeit in der Kindertagesbetreuung geworden. In Nordrhein-Westfalen ist Beobachten und Dokumentieren gesetzlich im Kinderbildungsgesetz (§ 18 KiBiz) verankert.
In den Bildungsgrundsätzen für NRW wird das Beobachten und damit einhergehend das Erfassen individueller Voraussetzungen sowie das Einschätzen der Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes einzelnen Kindes als eine unverzichtbare Grundlage für die pädagogische Planung angesehen, um das Kind kontinuierlich, individuell und optimal zu unterstützen. Es bildet eine der Grundlagen für den Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag der pädagogischen Fachkräfte sowie für die Information und Beratung der Eltern.
Die Bildungsdokumentation soll sich in erster Linie an das Kind richten und im Rahmen der Partizipation die Beteiligung des Kindes selbst an seiner Bildungsbiografie unterstützen. Die Entwicklungsdokumentation gibt Hinweise über den Entwicklungsstand (z. B. die Sprachentwicklung) und die altersgerechte Entwicklung eines Kindes und die Überwindung von Entwicklungs-Meilensteinen. Die Dokumentation dient zur präventiven Gesundheitsvorsorge, Information und Beratung von Eltern.
In den Kindertageseinrichtungen und den Kindertagespflegestellen finden diese Beobachtungs- und Dokumentationsprozesse regelmäßig, alltagsintegriert und wahrnehmend statt. Das bedeutet, dass die pädagogischen Fachkräfte die einzelnen Kinder in ihren Bildungs- und Lernprozessen beobachten und das, was sie wahrnehmen, dokumentieren.
Es gibt unterschiedliche Beobachtungsverfahren und Instrumente, die in der Praxis genutzt werden. Viele von ihnen basieren auf einem sogenannten ressourcenorientierten Ansatz, der die Stärken des Kindes in den Vordergrund stellt. Grundsätzlich zielen die Beobachtungsverfahren darauf ab, Einblicke zu gewinnen, wofür sich das Kind aktuell thematisch interessiert, ob es sich wohlfühlt, wie es sich einbringt und mit anderen in Interaktionen tritt.
Hüpfen, springen, klettern, schaukeln, rennen: Kinder haben viel Freude an Bewegung. So lernen sie sich und ihre Umwelt kennen, entwickeln ihre Persönlichkeit und fördern ihre Fähigkeit, kognitiv zu lernen. Der Landessportbund NRW zertifiziert Kindertageseinrichtungen, deren pädagogischer Schwerpunkt die Bewegungsförderung ist, mit dem Gütesiegel „Anerkannter Bewegungskindergarten“. Deutlichstes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Kindertageseinrichtungen ist, dass die Bewegungsförderung im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche des Kindergartenalltags und kommt so nicht nur den kindlichen Bedürfnissen nach Bewegung und Spiel entgegen, sondern öffnet den Kindern auch das Tor zum Lernen. Jeder „anerkannte Bewegungskindergarten“ kooperiert mit einem kinderfreundlichen Sportverein.
In NRW ist gesetzlich festgeschrieben (§ 17 KiBiz), dass eine pädagogische Konzeption in der Kindertagesbetreuung vorliegen muss. In dieser träger- oder einrichtungsspezifischen Konzeption wird unter anderem das Bildungsverständnis beschrieben. Dieses „Bild vom Kind“ und was Kinder für ihre Entwicklung brauchen beeinflusst das Denken und Handeln der pädagogischen Fachkräfte. Die damit einhergehende pädagogische Grundeinstellung und die sich daraus ergebenden Haltungen und Handlungen stellen das Kind mit seiner individuellen Entwicklung und der Entfaltung seiner Kompetenzen in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.
Folgende Grundgedanken lassen sich für das Bild vom Kind benennen:
- Das aktive, kreative Kind
„Ich möchte meine Umwelt entdecken und erforschen. Ich analysiere meine Umgebung und ziehe Schlussfolgerungen – so bilde ich mich selbst.
- Das kompetente Kind
„Über meine Wahrnehmung, mein Empfinden und mein Handeln mache ich Erfahrungen, um etwas zu lernen.“
- Das selbstständige, starke Kind
„Durch Sicherheit, Schutz und Unterstützung erhalte ich genug Selbstvertrauen und lerne den Umgang mit schwierigen Situationen.“
- Das soziale Kind
„Ich möchte mit anderen Menschen in Kontakt treten und brauche emotionale Sicherheit, Zuwendung und Wertschätzung.“
- Das konstruierende Kind
„Durch meine persönlichen Erfahrungen und Interaktionsprozesse mit der Umwelt konstruiere ich meine subjektive Welt.“
- Das einzigartige Kind
„Von Geburt an unterscheide ich mich von anderen Kindern – eine Chance, um miteinander und voneinander zu lernen.“
In der aktuellen Kita-Pädagogik sind Ansätze, die Kinder vornehmlich als zu schützende und zu belehrende Wesen betrachten, solchen Haltungen gewichen, die die Rechte und Stärken der Kinder betonen.
Quelle: Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (2018): Bildungskoffer NRW. Praxismaterialien zu den Bildungsgrundsätzen. Freiburg i. B.: Verlag Herder.
Eine Lesefassung der Bildungsgrundsätze für NRW finden Sie unter KiTa.NRW
Eine zweisprachige Einrichtung integriert neben Deutsch eine weitere Sprache im Alltag. Die Methode heißt „Immersion“, d. h. die Kinder erleben ein sogenanntes „Sprachbad“. Das Immersionsverfahren gilt derzeit als eine sehr erfolgreiche Sprachvermittlungsmethode. Hier wird die neue Sprache von einer oder mehreren pädagogischen Fachkräften in allen Alltagssituationen gesprochen. Diese Fachkräfte sind Muttersprachlerinnen und Muttersprachler (Native Speaker) oder haben eine sehr hohe fremdsprachliche Kompetenz erlangt. Die neue Sprache wird also nicht unterrichtet, sondern ist Umgangssprache.
Die Bindungstheorie wurde Ende der 1950er-Jahre von dem englischen Kinderpsychiater John Bowlby begründet. In der frühen Kindheit, d. h. bis zum Alter von 3 Jahren, geht es in der kindlichen Entwicklung vor allem um den Aufbau einer sicheren Bindung. Hat das Kind erfahren, dass die Bezugsperson sensibel und feinfühlig auf seine Äußerungen eingeht und es sich auf seine Bezugsperson verlassen kann, unterstützt das den Aufbau einer sicheren Bindung. Tiefgehende Bindungsbeziehungen geben dem Kind Sicherheit und sind die Basis des Kindes, die Welt aktiv zu erkunden. Eine sichere Bindung gilt als beste Voraussetzung für die Entwicklung kognitiver, emotionaler und sozialer Kompetenz, die zugleich als Schutzfaktor im Lebenslauf wirkt.
Neben der sicheren Bindung werden noch drei weitere Bindungstypen unterschieden:
- Ein Kind mit einer unsicher-vermeidenden Bindung hat wiederholt erfahren, dass seine (Bindungs-)Bedürfnisse nicht verstanden oder akzeptiert werden, und häufig Zurückweisung durch die Bindungsperson erlebt.
- Bei einem unsicher-ambivalenten Bindungstyp hat das Kind seine Bindungsperson als unberechenbar erlebt. Sein Bindungsverhalten ist daher ständig aktiviert. Diese Kinder haben häufig starke Trennungsängste und klammern sich an die Bindungsperson.
- Ein Kind mit einem unsicher-desorganisierten Bindungstyp zeichnet sich durch emotional widersprüchliches und inkonsistentes Bindungsverhalten aus. Auf der einen Seite sucht es die Zuwendung der Bezugsperson, hat aber gleichzeitig Angst vor ihr (oftmals infolge von Gewalterfahrungen, traumatischen Erlebnissen).
Der verinnerlichte Bindungstyp reguliert das Verhalten des Kindes zur Bezugsperson und strukturiert später das Verhalten und Erleben in allen emotional relevanten Beziehungen, einschließlich der zu sich selbst. So beeinflusst der Bindungstyp, inwieweit jemand in Beziehungen Nähe und Sicherheit erwartet und inwieweit er selbst Nähe zulassen kann.
Die Beziehungen zwischen Eltern und Kind sowie Fachkraft und Kind ähneln sich dadurch, dass beide Bezugspersonen dem Kind Sicherheit bieten und zum Entdecken anregen können. Die Erweiterung des Beziehungsnetzes durch den Besuch der Kindertagesbetreuung stellt für das Kind somit die Chance dar, (weitere) sichere Beziehungen mit bindungsähnlichem Charakter auszubilden. Für die Erweiterung des Beziehungsnetzes eines Kleinkindes bedarf es allerdings Zeit. Zugleich kommt es auf eine gute Übergangsgestaltung an, die stets von bestehenden Bezugspersonen des Kindes ausgehen sollte. Dies gilt für den ersten Übergang von der Familie in die Krippe ebenso wie für weitere Übergänge, wie beispielsweise den von der Krippen- in die Kindergartengruppe (siehe auch Eingewöhnung). Kann die Fachkraft eine Beziehung zu dem Kleinkind aufbauen, bildet dies eine positive Grundlage für das Wahrnehmen der Betreuungs- und Bildungsangebote.
Familienhandbuch. Karen Strohband, Bindung im Kindergartenalter
Ahnert, L. (Hrsg.) (2004): Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung. München: Ernst Reinhardt.
Susanne Stegmaier: Grundlagen der Bindungstheorie
Inzwischen gilt es in der Frühpädagogik als unumstritten, dass eine langsame, schrittweise, von einem Elternteil oder einer anderen engen Bezugsperson des Kindes begleitete Eingewöhnungsphase in die Kindertageseinrichtung oder bei einer Tagespflegeperson für das Wohl besonders jüngerer Kinder wichtig ist. In der Eingewöhnungsphase steht an erster Stelle der Beziehungsaufbau, für den Eltern und Fachkräfte gemeinsam Verantwortung tragen. Der Übergang von der Familie in die erste außerfamiliäre bzw. institutionelle Betreuung erfordert die Entwicklung einer sicheren und vertrauensvollen Bindung zu einer Fachkraft oder Tagespflegeperson.
Es gibt in Deutschland derzeit unterschiedliche Modelle der Eingewöhnung. Das älteste und verbreitetste Konzept ist das in den 1980er-Jahren entwickelte Berliner Eingewöhnungsmodell vom infans-Institut (Laewen, Andres & Hédérvari-Heller, 2011), welches auf Erkenntnissen der Bindungs- und Hirnforschung basiert. Eine weitere Variante für die Eingewöhnung ist das Münchener Eingewöhnungsmodell. Im Vergleich zum Berliner Modell werden hier zusätzlich Erkenntnisse aus der Transitionsforschung einbezogen.
Kindertageseinrichtungen, die gleichzeitig Familienzentren sind, bilden das Zentrum eines Netzwerks verschiedener Angebote für Kinder und Eltern. Sie vernetzen Kinderbetreuungsangebote mit Freizeit-, Beratungs- oder Therapiemöglichkeiten für Familien im Stadtteil und können ein Ort der Begegnung der Generationen sein. Familienzentren haben die Aufgabe, die Qualität der frühkindlichen Bildung und Förderung zu steigern, Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgabe zu stärken sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sichern. In Nordrhein-Westfalen wird der Ausbau von Kindertagesstätten zu Familienzentren seit 2006 gefördert. Rund ein Drittel der Kitas im Land haben sich zu Familienzentren weiterentwickelt.
Célestin und Elise Freinet, beide Schullehrkräfte, entwickelten die sogenannte Freinet-Pädagogik. Die vier wesentlichen Grundzüge dieses pädagogischen Ansatzes sind die Selbstverantwortlichkeit des Kindes, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, eine kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie Zusammenarbeit und gegenseitige Verantwortlichkeit. 1979 griff die erste Kindertageseinrichtung diesen Ansatz auf und übertrug ihn auf die Kindergartenpädagogik. Im Dialog mit den Kindern unterstützt die pädagogische Fachkraft jedes Kind individuell dabei, eigene Interessen und Bedürfnisse zu erkennen und diese nach seinen Wünschen auszudrücken. Dies passiert in Werkstätten und Ateliers wie z. B. Künstlerateliers, Holzwerkstätten, Töpfereien, Forscher- oder Technikateliers. Dort können sie frei experimentieren und dabei ihren eigenen Bedürfnissen und ihrem eigenen Rhythmus folgen. „Fehler“ sind Verbündete im Lernprozess und geben Entwicklungsimpulse. Pädagogische Fachkräfte haben die Verantwortung für den äußeren Rahmen, trauen den Kindern etwas zu und entdecken, was die Jungen und Mädchen können (s. Ressourcenorientierung). In Kinderkonferenzen und durch Kinderräte haben die Kinder Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten. Die Freinet-Pädagogik hat viele Berührungspunkte zu anderen kindzentrierten pädagogischen Ansätzen, besonders zur ‚Offenen Arbeit‘ und zur Reggio-Pädagogik.
Kindergartenpädagogik, Online-Handbuch
Website zur Freinet-Pädagogik
Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852) gilt als Erfinder des Kindergartens und Begründer der Spielpädagogik (freies Spielen). Der von ihm geprägte Begriff Kindergarten als eine „Schule des Spiels“ wurde unübersetzt in mehr als 20 Sprachen übernommen. 1837 eröffnete er den ersten Spielkreis. Das kindliche Spiel galt ihm als das „reinste geistige Erzeugnis des Menschen“. Spielzeuge – die sogenannten „Fröbelgaben“ – sollten zum kindlichen Erkenntnisgewinn beitragen. Aufgabe der Erwachsenen ist, das Kind anzuregen, seine Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Fröbel entwickelte eine für seine Zeit überaus moderne Sicht auf das Kind und erkannte die Kindheit als einen für Bildung und Erziehung besonders bedeutenden Abschnitt im Leben: Bildung kann nicht von außen her verordnet werden. Der Bildungsprozess geschieht als Selbstbildung, als ein vom Kind gesteuerter Wechselwirkungsprozess von „Inneres äußern“ und „Äußeres verinnerlichen“. Erziehung schafft laut Fröbel dazu geeignete Rahmenbedingungen und unterstützt den Bildungsprozess des Einzelnen in der jeweiligen Gesellschaft. Heute ist die Selbstbildung des Kindes Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Diskussionen. Die 2002 gegründete International Froebel Society Deutschland setzt sich für die Erforschung, Vermittlung und Aktualisierung von Fröbels Werk in Theorie und Praxis ein.
Aufsätze zur Fröbel-Pädagogik in: Kindergartenpädagogik, Online-Handbuch
International Froebel Society Deutschland
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich Deutschland verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem umzusetzen, das alle Menschen einbezieht. Gesonderte Kitas und Schulen für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sollen überflüssig werden. Inklusion soll sich nicht nur auf Kinder mit Behinderungen beziehen, sondern auf alle Kinder, die durch andere Faktoren wie ihre kulturelle oder soziale Herkunft von Benachteiligungen bedroht sind. Das Konzept der Inklusion unterscheidet sich von dem häufig synonym verwendeten Begriff der Integration. Integration bedeutet, dass eine neue Gruppe von Menschen in ein bestehendes Bildungssystem hereingeholt (integriert) wird. Inklusion setzt einen Wandel der Bildungseinrichtungen voraus, sodass sie für einen vielfältigeren Personenkreis gleich gute Verwirklichungschancen bietet. Das setzt eine pädagogische Haltung voraus, die Vielfalt wertschätzt und bewusst herbeiführt. Im Kinderbildungsgesetz NRW (§ 8) ist der Anspruch auf gemeinsame Förderung aller Kinder gesetzlich verankert.
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 22 a
Der Pädagoge, Genetiker und Psychologe Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis prägte den Ansatz der Ko-Konstruktion – des Lernens durch Zusammenarbeit. Er betont damit, dass Bildung ein sozialer Prozess ist. Kinder müssen die Welt konstruieren und ihr Bedeutungen geben, um sie zu verstehen (Konstruktivismus). Das geschieht in Austausch mit anderen (Kinder untereinander oder auch mit Erwachsenen). Erwachsene fördern den Prozess, indem sie die Erforschung von Bedeutung stärker betonen als den Erwerb von Wissen. Um mit Kindern in ko-konstruktive Lernprozesse eintreten zu können, sind Erwachsene gefordert, die Ausdrucksformen der Kinder genau zu beobachten. Nur dann können sie angemessen darauf reagieren. In der deutschen Pädagogik hat sich diese Auffassung durchgesetzt. Der methodische Ansatz, mit dem das Kind seinen Bildungsprozess steuert, ist das sogenannte „Selbstbildungskonzept“: Das Kind bildet sich selbst. Dieser Ansatz ist auch in den Bildungsgrundsätzen von NRW verankert.
Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis, Bildung neu definieren und hohe Bildungsqualität von Anfang an sichern.
Das Kita-Handbuch – Drei Formen der Bildung
Eine Lesefassung der Bildungsgrundsätze für NRW finden Sie auf KiTa.NRW
Begründerin der Montessori-Pädagogik ist die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori (1870–1952). 1907 gründete sie in Rom das erste Montessori-Kinderhaus. Montessori-Pädagogik wird heute in vielen Kinderhäusern und Schulen in fast allen Ländern der Erde angeboten. „Hilf mir, es selbst zu tun!“ – nach diesem Motto haben pädagogische Fachkräfte die Aufgabe, Kinder dabei zu unterstützen, selbst tätig zu werden. Maria Montessori ging davon aus, dass Kinder ihren „Bauplan“ in sich tragen. Sie machte auf die sogenannten sensiblen Phasen aufmerksam, in denen Kinder besonders empfänglich dafür sind, bestimmte Dinge – zum Beispiel Sprache, Bewegung oder Sozialverhalten – zu lernen. Durch Begleitung und Förderung gelingt es dem Kind, die in ihm wohnenden Kräfte gut zu entfalten. Freiarbeit ist das Kernstück der Montessori-Pädagogik. Die Kinder wählen nach eigener Entscheidung, womit sie sich beschäftigen. Maria Montessori entwickelte spezielles Spiel- und Lernmaterial, welches das Kind auf diesem Entwicklungsweg unterstützen soll. Dieses Material, die kindgerechte Darstellung der Angebote und die gute Beobachtungsgabe der pädagogischen Fachkräfte helfen dem Kind dabei, sich für ein Angebot zu entscheiden. Das Kind bestimmt den Arbeitsrhythmus und die Beschäftigungsdauer weitgehend selbst und auch, ob es allein oder mit einem Partner arbeiten, spielen oder lernen möchte.
Die Idee der „offenen Arbeit“ in Kindertageseinrichtungen verbreitete sich Ende der 1970er-Jahre. Das Konzept löst die bekannte Stammgruppenstruktur auf. Die traditionelle Raumaufteilung in Gruppenräume mit Funktionsbereichen (Bauecke, Puppenecke etc.) weicht einem Funktionsraumkonzept. Es gibt zum Beispiel ein Atelier, ein Bauzimmer, einen Bewegungsraum und ein Rollenspielzimmer. Kinder erhalten so die Möglichkeit, sich unabhängig von einer Gruppenzugehörigkeit mit Gleichgesinnten für einen Tätigkeitsbereich zu entscheiden. Das Konzept geht davon aus, dass sich Kindern in Zusammenhängen, die sie in höherem Maße selbst bestimmen können, bessere Lernvoraussetzungen bieten. Fachkräfte beobachten zum Beispiel, dass Kinder im Rahmen einer „offenen Arbeit“ mit Funktionsräumen engagierter und konzentrierter spielen, weil sie weniger abgelenkt werden. Jüngere Kinder kann ein offenes Konzept, das ihnen die Sicherheit nimmt, die die Gruppenstruktur bietet, überfordern, lautet ein Kritikpunkt. Viele Einrichtungen arbeiten daher nach einem teiloffenen Konzept, das die Vorteile beider Modelle zu verbinden sucht. Andere bieten Gruppenräume für die Jüngsten sowie feste Bezugserzieherinnen bzw. -erzieher, die auch den älteren Kindern als sichere Basis dienen, von der aus sie die Möglichkeiten der Räume Schritt für Schritt erkunden können.
Werke, Fotos, aufgeschriebene Kinderaussagen und andere Dokumente werden zusammen in einem Ordner gesammelt und dokumentieren den individuellen Entwicklungs- und Bildungsweg des Kindes. Im Portfolio drückt sich das Kind vor allem selbst aus. Dies geschieht u. a. dadurch, dass die Fachkräfte mit dem Kind besprechen, was Eingang in das Portfolio finden soll und warum. Die Kinder können ihre Bilder und Fotos kommentieren und ihnen z. B. Bildtitel geben. Die meisten Kinder lieben es, in ihren Portfolios zu blättern und so Vergangenes wieder lebendig werden zu lassen.
Portfolioarbeit ist Bildungsarbeit. In ihr setzen sich Kinder gedanklich, emotional und praktisch auseinander mit
- ihrer eigenen Person, ihrer Unverwechselbarkeit und Identität,
- ihren Interessen,
- ihrem Können,
- dem von ihnen selbst Geschaffenen,
- dem Erlebten,
- Schönem und Besonderem.
Das vom Kind präsentierte Portfolio ist eine gute Grundlage für Gespräche mit den Eltern über die Bildungs- und Entwicklungsprozesse ihres Kindes.
Britta Dehn, Das Portfolio bzw. das ICH-Buch des Kindes, eine stärkenorientierte Entwicklungsdokumentation, in: Online-Handbuch Inklusion als Menschenrecht
Tassilo Knauf: Kindern im Portfolio das Wort geben
Die Reggio-Pädagogik kommt aus der norditalienischen Stadt Reggio Emilia. Als einer ihrer bedeutendsten Vertreter gilt Prof. Loris Malaguzzi (1920–1994). Die Reggio-Pädagogik lässt sich als eine Erziehungsphilosophie beschreiben, in der die Vorstellung vom Kind als forschendes Wesen vertreten wird, das sich in „hundert Sprachen“, zum Beispiel in Worten, in Bildern oder im Spiel, auszudrücken vermag. Dabei fungiert die pädagogische Fachkraft als Entwicklungsbegleitung mit einer optimistischen und offenen Haltung. In der Reggio-Pädagogik spielen Projekte zur Gewinnung von alltagsbezogenen Fertigkeiten und vor allem von Selbst- und Weltverständnis eine besondere Rolle. Kindern stehen vor allem Materialien und Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie gestaltend tätig werden können. Die Kita-Räume und die dort angebotenen Materialien gelten als „dritter Erzieher“. Räume sollen einen hohen „Aufforderungscharakter“ besitzen und zu Aktivitäten anregen. Gleichzeitig ist es ihre Aufgabe, Rückzugsorte zu bieten. Daher sind die Räume überwiegend mit Schwerpunktfunktionen wie z. B. Kinderrestaurant, Atelier, Bauraum, Rollenspiel- oder Forscherraum gestaltet.
Lingenauber, Sabine (2016): Handlexikon der Reggio-Pädagogik. Bochum: Projektverlag.
Tassilo Knauf: Reggio-Pädagogik: kind- und bildungsorientiert
In Deutschland wird die Reggio-Pädagogik seit 1995 durch Dialog Reggio e. V. gefördert.
Unter Resilienz ist die menschliche Fähigkeit zu verstehen, mit belastenden Situationen gut und konstruktiv umzugehen. Viele Kinder wachsen heute unter erschwerten Bedingungen auf. Sie sind von verschiedensten Belastungen betroffen (Armut durch die Arbeitslosigkeit der Eltern, Scheidung der Eltern u. v. m.). Diese Belastungen stellen ein Risiko dar und wirken sich auf die Entwicklung des Kindes aus. Einige Kinder können den Belastungen kaum standhalten, andere jedoch entwickeln sich sehr gut. Kinder, die sich trotz dieser Risikofaktoren gut entwickeln, werden als „resilient“ bezeichnet
Ob Personen diese Fähigkeit besitzen, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Die Pädagogik in Kindertageseinrichtungen kann dazu beitragen, solche Faktoren zu stärken. Erfahren Kinder zum Beispiel, dass ihre Meinung zählt und sie ihre Stärken und Fähigkeiten entdecken und einbringen dürfen, entwickeln sie die Überzeugung, dass sie ihre Umwelt gestalten, beeinflussen und verändern können. Dieses Gefühl der „Selbstwirksamkeit“ ist eine wichtige Grundlage dafür, Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Weitere Resilienzfaktoren sind: eine positive Selbstwahrnehmung, die Fähigkeit, sich selbst gut zu steuern, soziale Kompetenzen, ein angemessener Umgang mit Stress sowie Problemlösekompetenzen.
„Was ist Resilienz?“, Informationen auf der Website zum Thema Resilienz des Zentrums für Kinder- und Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg
Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2010): Resilienzförderung im Kita-Alltag. Was Kinder stark und widerstandsfähig macht. Freiburg im Breisgau: Herder.
„Was muss ein Kind noch lernen?“ Diese Frage stand bei der Beobachtung von Kindern in Bildungseinrichtungen lange im Vordergrund. Heute weicht dieser auf die Defizite ausgerichtete Ansatz zunehmend einem ressourcenorientierten, der mit der Frage „Was kann das Kind schon?“ die Kompetenzen und Fähigkeiten der Kinder in den Vordergrund stellt. So rückt der Bildungsverlauf der Kinder in den Blick, die sich nicht mehr an einem idealtypischen Standard messen lassen müssen. Pädagogische Fachkräfte haben so die Möglichkeit, die Kinder von ihren Stärken und besonderen Begabungen ausgehend an Entwicklungsaufgaben heranzuführen. Steht das Kind mit seinem Können im Vordergrund, entsteht im Vergleich zur einseitigen Fokussierung der Defizite eine positive Einstellung zum Kind. Lässt die pädagogische Fach- oder Lehrkraft die Kinder erfahren, wo ihre Ressourcen liegen, erleichtert sie den Kindern, in bestimmten Situationen auf ihre Ressourcen zurückzugreifen und sie für sich nutzbar zu machen. Über das Stärken von Stärken und das damit einhergehende Selbstvertrauen können sich dann auch schwächer ausgebildete Fähigkeiten positiv entwickeln. Der Begriff der Ressourcenorientierung wird auch in anderen Zusammenhängen genutzt. In Kitas kann er auch bedeuten, dass die Fachkräfte die familiären bzw. sozialen Zusammenhänge der Kinder oder die Möglichkeiten, die das soziale Umfeld bietet, als Ressourcen erkennen und für die Kita-Arbeit nutzen.
Der in den 1970er-Jahren entwickelte Situationsansatz prägt seit rund 30 Jahren das Selbstverständnis vieler Frühpädagoginnen und -pädagogen in Deutschland und bildet die Basis für viele pädagogische Konzeptionen. Er basiert auf der Vorstellung, dass alltägliche Themen als „Schlüsselsituationen“ im Leben von Kindern ein besonderes Lernpotenzial bergen und in besonderer Weise auf das künftige Leben vorbereiten. Solche Themen und Situationen, die die Kinder aus ihrem Alltag mitbringen, werden in der Kindertageseinrichtung aufgegriffen und in Projekten bearbeitet. Der Situationsansatz hat das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft und mit verschiedenen Lebenserfahrungen dabei zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und zu gestalten. Wichtige Grundsätze sind die Mitbestimmung der Kinder im pädagogischen Alltag, die Schaffung einer anregungsreichen Lernkultur und die Pflege der Beziehungen zum sozialen Umfeld. Der Ansatz ist besonders geeignet, eine inklusive Pädagogik zu gestalten, die sensibel mit Vielfalt umgeht und niemanden ausschließt.
Der Situationsorientierte Ansatz ähnelt dem Situationsansatz. Der Unterschied besteht darin, dass Armin Krenz, Begründer dieses Ansatzes, davon ausgeht, dass Kinder in ihrem Verhalten, ihrem Spiel und in anderen Ausdrucksformen, Erlebnisse und Ereignisse verarbeiten, die sie in der Vergangenheit erlebt haben. Indem pädagogische Fachkräfte die darin zum Ausdruck kommenden Themen aufgreifen und die Kinder sie in Projekten auf vielfältige Weise bearbeiten, verarbeiten und verstehen sie diese. Durch diese unterschiedliche Herleitung ist der Situationsorientierte Ansatz individuell ausgerichtet, während der Situationsansatz ein gruppenpädagogisches Konzept ist.
Bianca McGuire, Cindy Benkel und Armin Krenz: Der Situationsorientierte Ansatz
Sprache zählt zu den wichtigsten Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen und den späteren Erfolg in Schule und Bildung. Besonders für Kinder am Anfang ihrer Sprachentwicklung und für Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, ist die frühe Sprachbildung und Unterstützung sprachlicher Kompetenzen von ausschlaggebender Bedeutung. Die Förderung der sprachlichen Entwicklung nimmt als zentrale Bildungsaufgabe somit zu Recht einen hohen Stellenwert im Elementarbereich ein. Die in den letzten Jahren gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Praxiserfahrungen zeigen, dass es vor allem eine systematische alltagsintegrierte Sprachbildung ist, die die sprachliche Entwicklung der Kinder fördert. Eine sprachanregende Umgebung im pädagogischen Alltag der Kindertagesbetreuung bietet dafür viele Anlässe. Sprachliche Bildung sollte möglichst früh beginnen und alle Kinder von Beginn an erreichen. In diesem Prozess ist die Gestaltung einer gelingenden Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Eltern und pädagogischen Kräften von entscheidender Bedeutung. Das familiäre Umfeld ist nach wie vor der erste Ort des Spracherwerbs. Der Austausch über Vorstellungen, Kenntnisse, Erfahrungen und Ressourcen hilft, ein gemeinsames Erziehungs- und Bildungsverständnis zu entwickeln.
Flyer für Eltern informiert über die „Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung für Kinder in Kindertageseinrichtungen in NRW“
Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ Informationen auf der Website der Initiative „Frühe Chancen“
Die Idee für Waldkindergärten stammt aus Dänemark, wo bereits 1954 die erste Kita dieser Art gegründet wurde. 1968 entstand der erste Waldkindergarten in Deutschland. Waldkindergärten unterscheiden sich von anderen Einrichtungen vor allem dadurch, dass die Kinder die Zeit nahezu ausschließlich und bei (fast) jedem Wetter im Wald verbringen. Vorgefertigtes Spielzeug gibt es in Waldkindergärten – bis auf wenige Werkzeuge – nicht. Die natürliche Umgebung schafft ständig Bewegungs-, Spiel- und Lernanlässe, die nicht erst künstlich geschaffen werden müssen. Sie fördert Kreativität, Fantasie, freies Spiel und das soziale Miteinander. Sogenannte Naturkindergärten nutzen neben Wäldern, Wiesen und Feldern auch andere Naturräume, wie Meer, Strand oder Dünen. Bei extremem Wetter können die Gruppen in der Regel einen Rückzugsraum (zum Beispiel eine Waldhütte oder einen Bauwagen) nutzen.
Die sogenannte Waldorfpädagogik wurde von Rudolf Steiner (1861–1925) begründet und basiert auf der von ihm entwickelten Menschenkunde, der Anthroposophie. 1926 entstand der erste Waldorfkindergarten in Stuttgart. Er war der dort 1919 eröffneten Waldorfschule angeschlossen. Steiner ging davon aus, dass sich in den ersten sieben Lebensjahren vor allem der Leib des Menschen und die inneren Organe ausbilden. Kinder nähmen in dieser Lebensphase die Welt vornehmlich durch Nachahmung auf. Die Kindergartenpädagogik in Waldorfeinrichtungen zeichnet sich durch Regelmäßigkeit und Wiederholungen aus, die Kindern Sicherheit gibt. Künstlerisches und handwerkliches Tun stehen im Vordergrund. Im freien Spiel zeigen die Kinder ihre Persönlichkeit. Beziehung, Freude und Bewegung gelten als wichtige Grundlagen für das Lernen. Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen ist es, dem Kind zu helfen, seine eigene Individualität zu entdecken.
Vereinigung der Waldorfkindergärten Region Nordrhein-Westfalen